Die siebte Runde der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen , die am 20. Juni stattfand, wurde von wachsenden Spannungen zwischen Peking und Berlin überschattet. Diese drehten sich um eine Reihe von Themen, von der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen Chinas zu Russland trotz des Krieges in der Ukraine bis hin zu den Spannungen in der Taiwanstraße.
Und der irreparable Riss zwischen China und den Vereinigten Staaten – einem Verbündeten Deutschlands – verschärft die Situation nur noch.
„Gemeinsam nachhaltig handeln“ war das Motto der 7. Runde der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, an der der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und mehrere Mitglieder seines Kabinetts teilnahmen.
Doch das Gefühl der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China schwindet, während das Gefühl der Spannungen bestehen bleibt.
Dies zeigte sich kürzlich bei einem Treffen zwischen dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur, nachdem bekannt geworden war, dass ehemalige Offiziere der deutschen Luftwaffe an einem chinesischen Pilotenausbildungsprogramm beteiligt waren. Pistorius forderte ein sofortiges Ende dieses Programms.
Thorsten Benner, Direktor des German Public Policy Institute (GPPi), einer unabhängigen Denkfabrik mit Sitz in Berlin, sagte der DW, dies sei „ein Zeichen dafür, dass wir wachsam sein müssen, weil Peking jede Gelegenheit nutzt, um Zugang zu wichtigen Technologien oder Fähigkeiten zu erhalten, um seine eigene industrielle und militärische Basis zu stärken.“
Sowohl Partner als auch Wettbewerber
Der Konflikt zwischen Peking und Berlin hat sich aufgrund einer Reihe von Themen verschärft, angefangen von Chinas Erklärung einer „unbegrenzten“ Partnerschaft mit Russland trotz des anhaltenden Konflikts in der Ukraine bis hin zu den zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße und der Frage der uigurischen Minderheit in Xinjiang.
Und Chinas Rivalität mit den USA, einem Verbündeten Deutschlands, macht die Sache nur noch schlimmer.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang trifft am 19. Juni 2023 in Berlin den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Li Qiangs Wahl Deutschlands für seine erste Auslandsreise als Ministerpräsident spiegelt die besondere Beziehung zwischen Europas führender Volkswirtschaft und dem asiatischen Riesen wider. Foto: DW
China bleibt 2022 jedoch zum siebten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Der bilaterale Handel wird sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auf rund 300 Milliarden Euro belaufen, ein Plus von rund 21 % gegenüber 2021. Zudem belief sich das deutsche Handelsdefizit mit China im vergangenen Jahr auf 84 Milliarden Euro.
Offizielle deutsche Dokumente bezeichnen China als „Partner“, „Konkurrenten“ und „strategischen Rivalen“. Die Bundesregierung betont seit langem den kooperativen Aspekt, wie bilaterale Konsultationen seit 2011 belegen. Solche hochrangigen Dialoge werden nur mit besonders engen Partnern geführt.
Im Jahr 2014 wurde die Beziehung sogar zu einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ erhoben. Doch seitdem hat sich die Stimmung in Berlin und anderen EU-Hauptstädten gegenüber China verschlechtert: Aus dem Partner ist ein strategischer Rivale geworden.
Letzte Woche veröffentlichte die Bundesregierung ihre Nationale Sicherheitsstrategie. Darin wird deutlich, dass Berlins Schwerpunkt seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine von wirtschaftlichen Interessen auf Geopolitik verlagert wurde. Deutschland äußerte sich in dem Strategiedokument unverblümt über seinen wichtigsten Handelspartner.
„China nutzt seine wirtschaftliche Macht gezielt, um politische Ziele zu erreichen“, heißt es in dem Dokument. Gleichzeitig wird anerkannt, dass China weiterhin ein Partner sei, den die Welt brauche, um globale Herausforderungen und Krisen zu bewältigen.
Analysten weisen darauf hin, dass die Abwehr von Bedrohungen oder die Verhinderung größerer Überraschungen in der Strategie keine Priorität haben. Sie ignoriert zudem wichtige Themen wie Taiwan und sieht keinen Nationalen Sicherheitsrat zur Unterstützung der Umsetzung vor.
„Dies ist ein großer Wandel, den wir in Deutschland in der Sicherheitspolitik vollziehen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Vorstellung des Dokuments. Er wolle von einer Militärstrategie zu einem umfassenden Sicherheitskonzept übergehen. Er fügte hinzu, dass eine detaillierte Fassung der von seiner Regierung ausgearbeiteten China-Strategie bald veröffentlicht werde.
Beratung ist wichtig
Eine Verzögerung der Bekanntgabe der konkreten Strategie Berlins gegenüber Peking – aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierungskoalition – würde bilaterale Gespräche wie diese siebte Runde der Regierungskonsultationen erleichtern, sagte Eberhard Sandschneider, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
„Wenn es jetzt ein Dokument gibt, das China zu kritisch gegenübersteht, ist es sehr wahrscheinlich, dass Peking – in seinem Stolz – die Konsultationen ganz absagen wird“, sagte Sandschneider. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in der deutschen Regierung interne Meinungsverschiedenheiten gibt. Das wissen auch die Chinesen.“

Von links: Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Bundesinnenministerin Nancy Faeser während der Zeremonie zur Vorstellung der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie am 14. Juni 2023. Foto: Bloomberg
Dies ist nicht verwunderlich, da es in der Öffentlichkeit zu Debatten kommt, insbesondere zwischen der Grünen Partei, die eine harte Linie gegenüber China vertritt, und der Sozialdemokratischen Partei (SPD) von Bundeskanzler Scholz, die sich eher auf wirtschaftliche Interessen konzentriert.
Während beispielsweise die grüne Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Peking im April versuchte, öffentlich mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang zu „streiten“, veröffentlichte der konservative Flügel der SPD ein Positionspapier, in dem er zu einer pragmatischeren statt einer feindseligen Politik aufrief.
Zwar gebe es zwischen Frau Baerbock und Herrn Scholz große Unterschiede, und Deutschlands derzeitiger Umgang mit China sei von Parteipolitik geprägt, doch Frau Pongratz vom Mercator-Institut sagte: „Wenn man genau hinhört, wird man feststellen, dass es Unterschiede im Ton gibt, die Botschaft jedoch nicht sehr unterschiedlich ist.“
Da Herr Scholz die Beratungsrunde am 20. Juni leiten wird, ist erkennbar, dass der deutsche Gastgeber gegenüber den Gästen aus China einen freundlicheren Ton anschlägt.
Herr Sandschneider erwartete keine konkreten Ergebnisse, sagte jedoch, dass es wichtig sei, dass die Gespräche stattfinden, insbesondere nachdem es drei Jahre lang keine größeren persönlichen Gespräche zwischen Deutschland und China gegeben habe.
„Ich stimme meinen chinesischen Kollegen zu, mit denen ich gesprochen habe“, sagte er. „Es ist an der Zeit, dass sich Vertreter beider Seiten wieder treffen, und zwar nicht nur in formellen Treffen, sondern auch in persönlichen Kontakten am Rande der Konsultationen. Das würde die Atmosphäre verändern . “
Minh Duc (Laut DW, Reuters)
[Anzeige_2]
Quelle







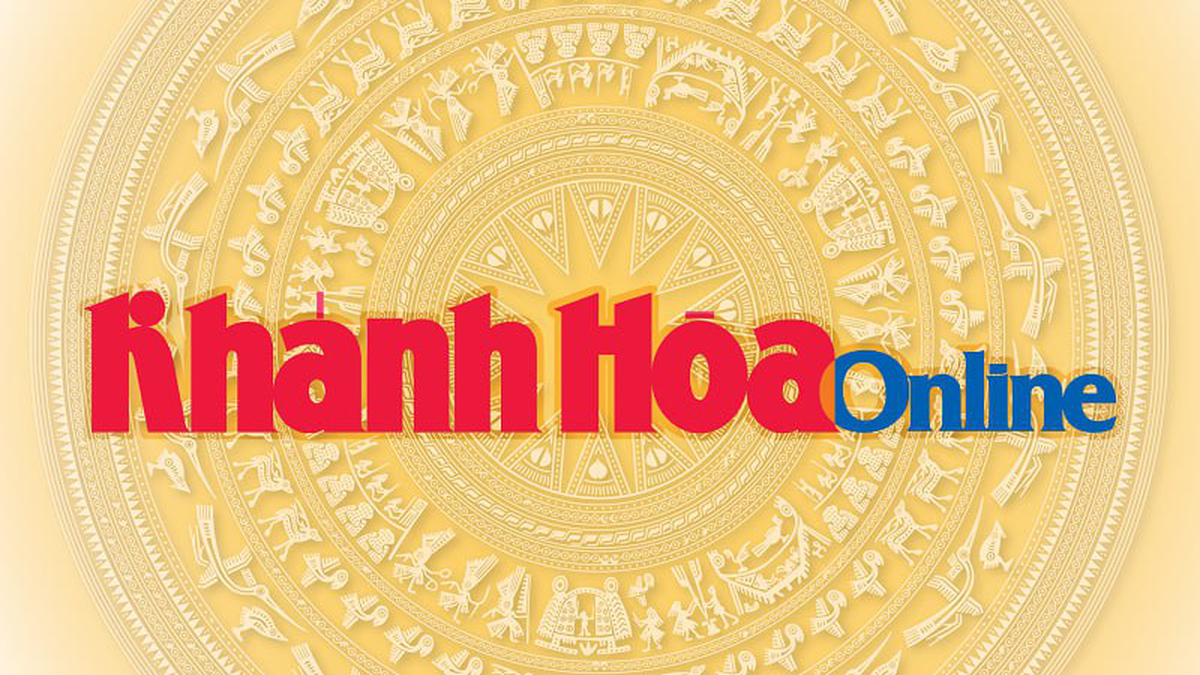































































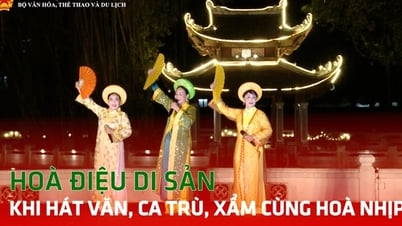




























Kommentar (0)