Auswirkungen internationaler Sport- , Kultur- und Tourismusveranstaltungen
Große Sportereignisse wie Olympische Spiele, Paralympics, Weltmeisterschaften oder internationale Ausstellungen werden von einem großen Publikum mit Spannung erwartet. Die einzigartige Anziehungskraft, die breite Medienpräsenz und die erheblichen positiven Auswirkungen auf das Leben der lokalen Gemeinschaften sind wichtige Faktoren für das Gastgeberland, um eine spezifische, manchmal mutige Strategie und einen Aktionsplan zu entwickeln.
Von diesen großen internationalen Veranstaltungen werden zwei Arten von wirtschaftlichen Effekten erwartet: kurzfristige und langfristige. Die kurzfristigen Vorteile ergeben sich hauptsächlich aus den Ausgaben der Besucher und Organisatoren während der Planung und Durchführung der Veranstaltung.
Die Bank von Frankreich schätzt, dass die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris im dritten Quartal 2024 0,25 % zum BIP-Wachstum in der Hauptstadtregion Île-de-France beitrugen. Der Flugverkehr an den Pariser Flughäfen überstieg im Jahr 2024 zum ersten Mal seit 2019 die Marke von 100 Millionen Passagieren.
In einem am 18. Juli 2007 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichten Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Fußball- Weltmeisterschaft 2006 in der Bundesrepublik Deutschland heißt es: „Dieses internationale Ereignis des Königssports hat dazu beigetragen, 34.000 zusätzliche Arbeitsplätze für die Bevölkerung zu schaffen.“
In sozialer Hinsicht haben solche internationalen Veranstaltungen das Potenzial, den sozialen Zusammenhalt unabhängig von Alter, Geschlecht, Schicht oder Kultur zu fördern. Zahlreiche Begleitprogramme fördern inklusive Werte und unterstützen Menschen mit Behinderungen, benachteiligte Jugendliche und Frauen. Die Straßen- und Schieneninfrastruktur in den Städten, in denen die Spiele stattfinden, wurde deutlich verbessert.
Frankreich hat außerdem frühzeitig den Ausbau seiner Infrastruktur mit einem doppelten Ziel geplant: Zum einen soll sie den Olympischen Spielen 2024 dienen, zum anderen soll sie zum langfristigen Nutzen der Bevölkerung umgestaltet werden, um eine Überbauung zu vermeiden.
Aufbau und Förderung von „Vermächtnissen“ nach der Veranstaltung
In Portugal war die Expo 1998 in Lissabon mit dem Thema „Ozeane, Erbe für die Zukunft“ eine der ersten Ausstellungsveranstaltungen, die mit dem Ziel organisiert wurde, den Veranstaltungsort in die Stadtplanungspolitik zu integrieren.
Die Expo 1998 in Lissabon trug dazu bei, die portugiesische Hauptstadt auf der internationalen und europäischen Bühne als kosmopolitische, moderne, wettbewerbsfähige und attraktive Stadt neu zu positionieren.

Die Expo 1998 in Portugal wurde am ersten Tag ihrer Eröffnung von vielen Besuchern begeistert aufgenommen. (Foto: LisboaSecreta)
Die Regierung von Lissabon nutzte nicht nur die verbesserte Anbindung stillgelegter Hafengebiete für die räumliche und wirtschaftliche Entwicklung, sondern renovierte auch das Hafengebiet und reagierte damit auf eine starke gesellschaftliche Forderung nach der Wiederherstellung des Hafengebiets für gemeinschaftliche Zwecke.
Das 340 Hektar große Industriegebiet am Wasser östlich von Lissabon wurde in einen urbanen Raum umgewandelt. Weitere positive Veränderungen sind die geringere Umweltverschmutzung, verbesserte sanitäre Einrichtungen und neue öffentliche Einrichtungen wie Museen, Theater und Einkaufszentren.
Nach der Expo 1998 in Lissabon wandelte die portugiesische Regierung die für die Expo 1998 in Lissabon genutzten Gebäude in kulturelle und künstlerische Räume um, um das kulturelle und spirituelle Leben der Menschen zu verbessern.

Die Grünflächen des Expo-1998-Ausstellungsgeländes wurden später für Gemeinschaftsaktivitäten umgenutzt. (Foto: LisboaSecreta)
Der Erfolg der Vorbereitung, Umsetzung und Förderung des Kulturerbewerts nach der Expo 1998 wurde zu einem „Modell“ für Stadterneuerungsprojekte und -initiativen in den folgenden Jahren.
Um diesen Erfolg zu wiederholen, hat das portugiesische Ministerium für Umwelt und Raumplanung im Jahr 2000 das Polis-Programm ins Leben gerufen, um Erfahrungen an städtische Planungsinstitutionen im ganzen Land weiterzugeben.
In der Bundesrepublik Deutschland löste die Fußballweltmeisterschaft 2006 einen Boom beim Bau völlig neuer Stadien und bei der umfassenden Renovierung bestehender Einrichtungen aus, der sich nicht nur auf die zwölf Austragungsstädte beschränkte, sondern sich auch auf viele andere Orte im ganzen Land ausweitete.
Laut einem Artikel des deutschen Soziologen und Professors Albrecht Sonntag, der am 17. November 2022 auf der digitalen Magazinplattform PREO veröffentlicht wurde, stieg die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Spiel in den deutschen Fußballligen zwischen 2000 und 2018 dramatisch um 42 %, was einer Zunahme von 31.182 auf 44.511 Personen entspricht, wobei die Stadionauslastung stets über 90 % lag.
Die Straßen- und Schienennetze rund um die Austragungsorte waren bereits von der deutschen Regierung geplant und finanziert worden. Doch die Fußballweltmeisterschaft 2006 wirkte als „Katalysator“ und beschleunigte die Umsetzung der Pläne.

Das im Münchner Olympiapark gelegene Stadion bietet bei internationalen Spielen eine Kapazität von bis zu 70.000 Zuschauern. (Foto: StadiumDB)
Die Fußballweltmeisterschaft 2006 wurde als „Sommermärchen“ bezeichnet, weil sie in der Bevölkerung Patriotismus und Solidarität weckte.
Dieses internationale Fußballereignis trägt auch dazu bei, die Wahrnehmung Deutschlands in der Weltöffentlichkeit zu verändern, indem es dazu beiträgt, überholte Stereotypen zu korrigieren und ein Bild von Deutschland als offen, großzügig und unterhaltsam zu vermitteln.
In seinem Artikel über die PREO-Plattform zitiert Professor Albrecht Sonntag zudem eine Studie, die zeigt, dass Deutschland im Nation Brands Index im Jahr 2006 vom sechsten auf den ersten Platz aufgestiegen ist.

Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. (Foto: Eurosport)
Eine der nachhaltigsten Neuerungen der WM 2006 war die Schaffung öffentlicher Fanbereiche. Millionen von Menschen, die die Spiele nicht persönlich besuchen konnten, konnten dank riesiger Bildschirme und ehrenamtlicher Betreuung dennoch an den Feierlichkeiten teilnehmen. Diese öffentlichen Bereiche wurden zu einzigartigen Attraktionen und förderten soziale Interaktion und Gemeinschaftsgefühl.
Großbritannien ist eines der Länder, die seit langem vom „Erbe internationaler Ereignisse“ profitieren.
Das Olympiastadion London 2012 wurde ursprünglich für die Olympischen Sommerspiele 2012 gebaut. Seit 2016 heißt es offiziell London Stadium und ist die Heimat des Fußballvereins West Ham United. Darüber hinaus wird es auch für Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Rugbyspiele, Konzerte usw. genutzt.

Die olympische Fackel während der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London. (Foto: IOC)
Das Wassersportzentrum wurde mit leicht reduzierter Kapazität wiedereröffnet und steht Schulen, örtlichen Vereinen, der Öffentlichkeit und Sportlern während des Trainings zur Verfügung.
Sportzentren wie Copper Box, Eton Manor und Lee Valley haben sich zu erstklassigen Trainings- und Wettkampfstätten sowie Mehrzwecksportzentren für die Gemeinde entwickelt und tragen dazu bei, den Sportunterricht und die sportlichen Aktivitäten in vielen Gegenden zu fördern.
Großbritannien hat außerdem ein Großprojekt gestartet, das darauf abzielt, in den fünf Jahren nach den Spielen eine Milliarde Pfund zu investieren und 6.000 neue Sportvereine in der Gemeinde zu gründen.
Ein Paradebeispiel ist die 135 Millionen Pfund teure Initiative „Places People Play“ zur Umgestaltung von Sportstätten mit einer Investition von 20 Millionen Pfund in 377 kommunale Sportprojekte im ganzen Land.
Damals förderte das Bildungsprogramm „Get Set“ den olympischen Geist in den Schulen, wobei Werte wie Freundschaft, gegenseitiger Respekt und Verständnis vermittelt wurden. Fast 85 % der Schulen in Großbritannien nahmen daran teil.

Kinder nehmen an Aktivitäten des „Get Set“-Programms teil. (Foto: IOC)
Das größte Kunst- und Kulturprogramm in der britischen Geschichte dauerte 12 Wochen. Mehr als 25.000 Künstler aus 204 Ländern gaben 13.000 Vorstellungen an 1.200 Veranstaltungsorten und zogen 19,8 Millionen Zuschauer an.
Zusätzlich zu den 250.000 Kandidaten für die 70.000 olympischen Freiwilligenpositionen förderten die Olympischen Spiele 2012 in London auch die soziale Inklusion, indem sie über 30.000 Arbeitslosen in der Hauptstadt London dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten boten.
Der Erfolg der nachhaltigen Entwicklung und des Bauens in Großbritannien bei den Olympischen Spielen 2012 bestand in der Umwandlung eines brachliegenden Industriegebiets in den größten Stadtpark Europas mit einer Fläche von 100 Hektar. Dieser Park bietet heute vielen Wildtierarten ein Zuhause und verfügt über ein vielfältiges Ökosystem und Terrain.
Die Olympischen Spiele 2012 in London waren auch Vorreiter bei der Entwicklung einer Methode zur Messung des CO2-Fußabdrucks von Großveranstaltungen, die bei der darauffolgenden Ausgabe in Rio 2016 übernommen und 2019 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als standardisiertes Messinstrument finalisiert wurde.

Der Verkehrsplan für die Olympischen Spiele 2012 in London ermutigt Besucher und Sportfans, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. (Foto: IOC)
Das Olympische Dorf wurde später in ein Wohngebiet mit 2.800 neuen Wohnungen umgewandelt, was zur Deckung des Wohnungsbedarfs beitrug. Auch das Verkehrssystem in der Region wurde deutlich verbessert: Zehn neue Eisenbahnlinien und 30 neue Brücken stehen den Bewohnern auch nach den Spielen zur Verfügung.
Darüber hinaus wurden mehr als 60 umweltfreundliche Verkehrsprojekte gestartet, darunter 10 Millionen Pfund, die in Radwege und Fußgängerüberwege investiert wurden. Eine Flotte von 200 Elektroautos und 120 Ladestationen wurde eingerichtet, was damals als das größte Ladenetz in Großbritannien galt.
Der 2013 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Das Erbe der Spiele“ zitierte eine Studie von Oxford Economics, die zeigte, dass die Olympischen Spiele der britischen Wirtschaft im Zeitraum 2015–2017 16,5 Milliarden Pfund einbringen könnten.
Und tatsächlich halfen die Erfahrungen aus London 2012 britischen Unternehmen auch dabei, bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi und der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 über 60 Aufträge zu gewinnen.
Die Nachhaltigkeit zeigt sich auch in den 110.000 neuen Arbeitsplätzen, die 2017 rund um den Queen Elizabeth Park geschaffen wurden. Bis 2025 werden weitere 40.000 erwartet.
Darüber hinaus trug die Begeisterung für die Olympischen Spiele 2012 in London dazu bei, im Jahr 2015 weitere vier Millionen Touristen anzulocken, wodurch 14.000 Arbeitsplätze in der Tourismusbranche geschaffen wurden und die Ausgaben internationaler Besucher in den drei Jahren nach den Spielen um 2,7 Milliarden Pfund stiegen.
In der Französischen Republik hieß es in dem von der Regierung der Hauptstadtregion Île-de-France im Jahr 2024 veröffentlichten zusammenfassenden Bericht eindeutig: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris waren ein „historisches Ereignis“ mit großem Erfolg und 11,2 Millionen Besuchern und fast 5 Milliarden Zuschauern weltweit.
Darin bekräftigte Frau Marie Barsacq, Ministerin für Sport, Jugend und Vereinsaktivitäten, dass Frankreich „die während der Kandidaturzeit gemachten Versprechen erfüllt“ habe. Zu den wichtigsten Zielen gehörten die Förderung des Breitensports, die Verbesserung der Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung des inklusiven Zugangs für alle.

Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 werden in den Schulen der jeweiligen Region normale Schwimmbäder zum Schwimmunterricht für Schüler umgebaut. (Foto: MINH DUY)
Es wurden umfangreiche und systematische Investitionen in die sportliche und städtische Infrastruktur getätigt, mit einem Gesamtbudget von über 50 Millionen Euro allein in der Hauptstadtregion. Das Département Seine-Saint-Denis am Stadtrand von Paris, wo die meisten Spiele stattfinden, hat erheblich von diesen nationalen Programmen profitiert.
Nach den Ereignissen bot das Olympische Schwimmzentrum in Seine-Saint-Denis den örtlichen Schulkindern jährlich bis zu 2.100 Schwimmstunden an. Die olympischen und paralympischen Schwimmbecken wurden ebenfalls abgebaut und in den beiden Städten Sevran und Bagnolet in den nordöstlichen Vororten von Paris wieder aufgebaut, wo sie weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung standen.
Auch viele andere Sportgeräte werden sinnvoll wiederverwendet, etwa Sand vom Beachvolleyballfeld am Fuße des Eiffelturms oder Skateboard-Module, die in die beiden Städte Marville und Noisy-le-Sec transportiert werden, um dort weiterhin genutzt zu werden.

Das Olympische Mediendorf Paris 2024 wurde in ein gemischt genutztes Stadtgebiet mit 1.300 Wohnungen umgewandelt. Damit entstehen in der Region Seine-Saint-Denis insgesamt 4.100 neue Wohnungen. (Foto: KHAI HOAN)
Durch die Umwandlung des Athletendorfs und des Mediendorfs in Wohngebiete sind in Seine-Saint-Denis 4.100 neue Wohnungen entstanden, deren Design Wohnraum, Geschäfte, Büros und öffentliche Einrichtungen integriert.
Das Projekt zur Reinigung der Flüsse Seine und Marne mit einer Gesamtinvestition von 1,1 Milliarden Euro hat dazu beigetragen, dass die Wasserqualität internationalen Standards entspricht und seit Sommer 2025 drei natürliche Badebereiche für die Pariser Bevölkerung geöffnet werden.
Acht Projekte zur Verbesserung der Barrierefreiheit lokaler Sportanlagen wurden mit über 371.000 Euro gefördert, darunter die Anschaffung von Spezialfahrzeugen, Fahrrädern und Geländerollstühlen für Menschen mit Behinderung, Ausrüstung für Wassersport für Menschen mit Behinderung sowie die Installation von Outdoor-Sportböden für Rollstuhlvolleyball.
Man kann sagen, dass die Olympischen Spiele 2024 in Paris dem Behindertensport neuen Schwung verliehen haben. Der französische Behindertensportverband verzeichnete mit fast 35 % neuen Mitgliedern auch das größte Wachstum.

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris fand an der poetischen Seine statt. (Foto: MINH DUY)
Auch der öffentliche Nahverkehr wurde durch Projekte wie die Erweiterung der Pariser Metro und der interregionalen Straßenbahnlinien sowie fünf neue Fußgänger- und Fahrradbrücken in Seine-Saint-Denis deutlich verbessert.
Es wurden 120 km neue Radwege gebaut, wodurch sich das Gesamtnetz dieses umweltfreundlichen Verkehrsmittels auf 400 km erhöht und ein Beitrag zur Veränderung des nachhaltigen Stadtverkehrs geleistet wird.
Während der Olympischen Spiele in Paris waren über 30.000 Arbeitslose beschäftigt, und bis Ende 2024 hatten 96,5 % von ihnen weiterhin ihren Arbeitsplatz.
Touristenattraktionen, Ausstellungen und Museen verzeichneten Rekordbesucherzahlen und Hotelübernachtungen, was sich positiv auf Tourismus und Kultur auswirkte. Allein das Petit Palais in Paris verzeichnete einen historischen Rekord von 1,5 Millionen Besuchern, und der Pompidou-Komplex verzeichnete einen Anstieg von 22 % bzw. 3,2 Millionen Besuchern.

Jeder Bürger, unabhängig von Alter, Beruf oder Interessen, kann in den Fanzonen, die in jeder Stadt Frankreichs eingerichtet werden, sportliche Aktivitäten erleben. (Foto: MINH DUY)
Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird die olympische „Fackel“ in Form eines einzigartigen Heißluftballons weiterhin im Tuileriengarten im Herzen der Hauptstadt existieren und den Stolz und den Wunsch der Pariser und des ganzen Landes zum Ausdruck bringen, die Symbole der Olympischen Spiele zu bewahren.
Bis heute ist die französische Regierung weiterhin bestrebt, die Nachfolgepolitik von Paris 2024 beizubehalten und sich sorgfältiger und effektiver auf die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2030 in den Alpen vorzubereiten.
Erfahrung in der Förderung des Wertes des „internationalen Veranstaltungserbes“
Laut Pierre Rabadan, dem stellvertretenden Bürgermeister von Paris und verantwortlich für Sport und die Olympischen Spiele 2024, geht es bei internationalen Sport-, Kultur- und Tourismusveranstaltungen nicht nur um kurzfristige „Leistungen und Punkte sammeln“, sondern sie müssen in einen „langfristigen“ Plan für eine nachhaltige Entwicklung im Anschluss an viele Jahre eingebunden werden.
Internationale Sport- oder Kulturereignisse bieten in der Stadtplanung die Möglichkeit, Investitionen und Entwicklung in Gebieten mit schwacher Infrastruktur als Veranstaltungsorte zu priorisieren. Dann können die Menschen vor Ort ihre Freizeit genießen.
Veranstaltungseinrichtungen wie Stadien, öffentliche Plätze, Ausstellungsbereiche, Parkplätze usw. können an bestehenden Standorten renoviert oder auf der Grundlage vorab berechneter Wiederverwendungsoptionen neu gebaut werden, um den Menschen zu dienen und so Vernachlässigung und Budgetverschwendung zu vermeiden.
Der Schlüssel liegt darin, das Tempo beizubehalten und auf dem langfristigen Wert internationaler Veranstaltungen aufzubauen. Ohne eine nachhaltige Strategie nach der Veranstaltung verfallen Strukturen schnell, Verpflichtungen geraten in Vergessenheit und die Begeisterung der Community lässt nach.

Die Seine und die Marne in Frankreich werden ab Sommer 2025 zum sicheren Schwimmen geöffnet sein. Drei Badestellen befinden sich im Herzen von Paris und mehrere weitere entlang der Marne in den Vororten. (Foto: KHAI HOAN)
Jede regionale und internationale Veranstaltung zieht oft die Aufmerksamkeit eines großen Publikums aus vielen Ländern der Welt auf sich, sei es direkt oder über die Massenmedien. Daher muss das Gastgeberland bei der Organisation von Veranstaltungen umfassend in eine internationale Kommunikationsstrategie investieren und die Förderung von Kultur, Küche, Reisezielen und nationalen Produkten in der Welt integrieren.
Die Konzentration auf den Aufbau eines Expertenteams, die Vernetzung mit internationalen Organisationen und Verbänden sowie die Schaffung einer professionellen Event-Lieferkette trägt auch dazu bei, den Ruf des Gastgeberlandes bei der Ausrichtung nachfolgender Veranstaltungen in vielen Bereichen zu verbessern.
Quelle: https://bvhttdl.gov.vn/phat-huy-di-san-su-kien-quoc-te-o-chau-au-20250801093635853.htm











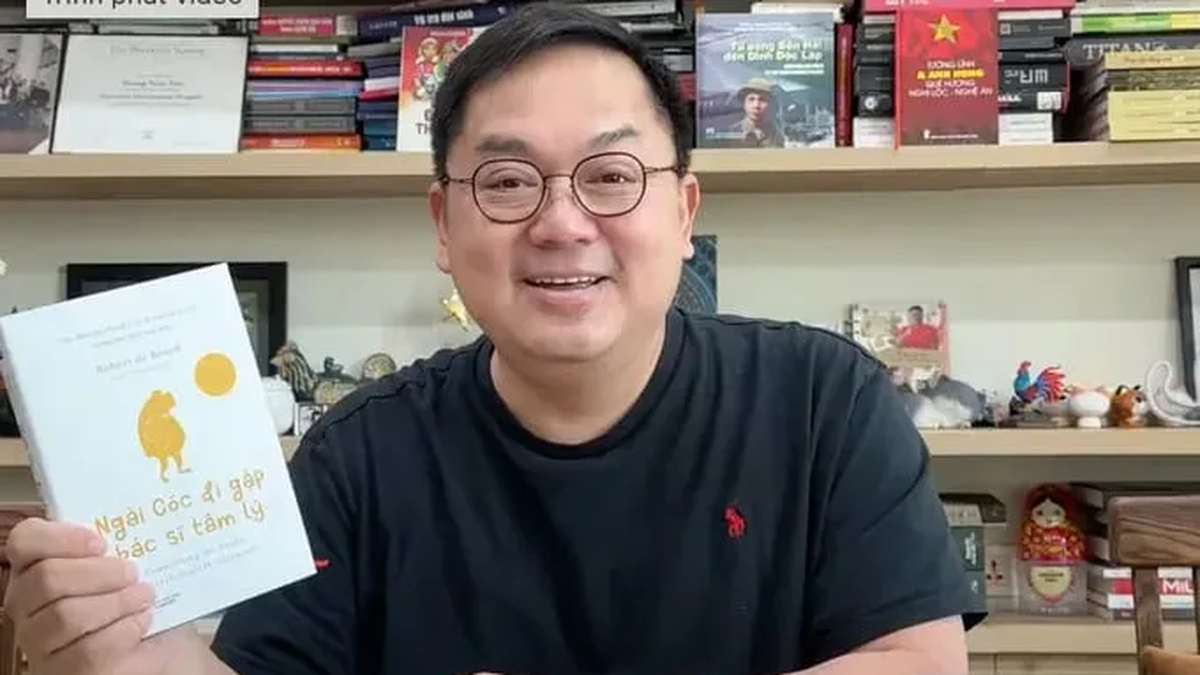
















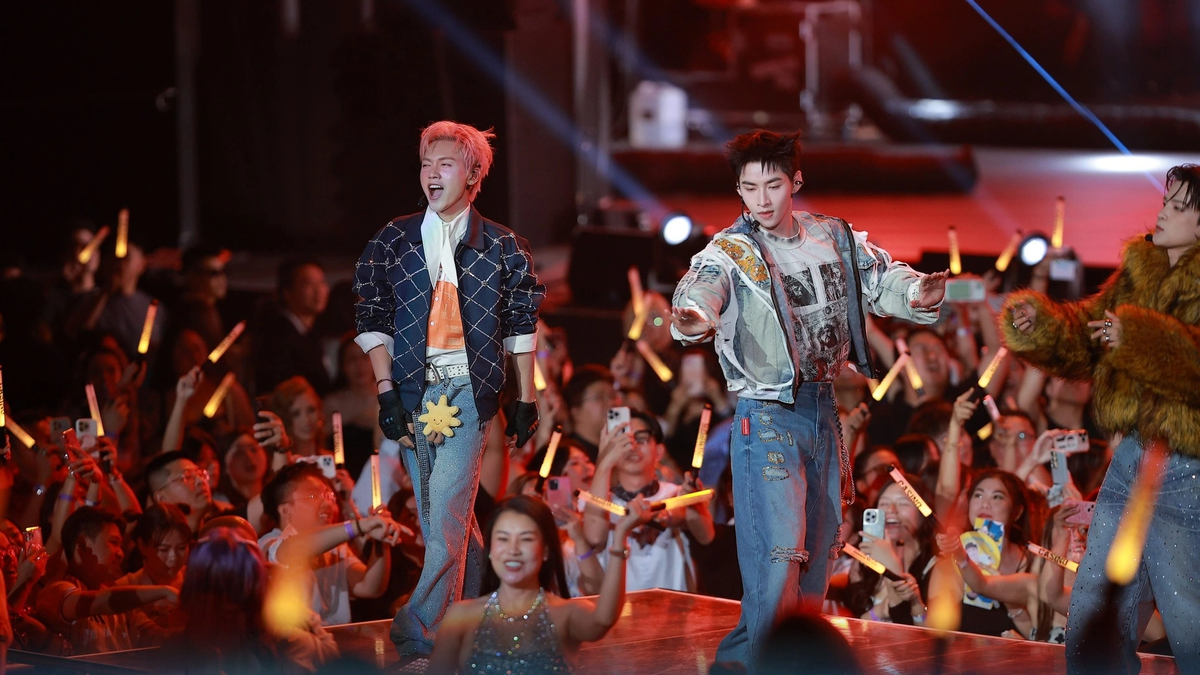
















































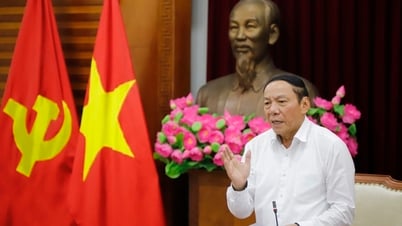


















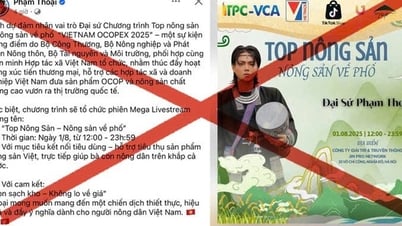





Kommentar (0)