Eskalierende Handelsspannungen zwischen China und der EU
Kurz nachdem der chinesische Außenminister Wang Yi seine Europareise beendet hatte, kündigte das chinesische Handelsministerium einen dauerhaften Antidumpingzoll von 34,9 Prozent auf importierte Spirituosen aus der EU, darunter auch französischen Cognac, an. Die Maßnahme trat am 5. Juli in Kraft und gilt für fünf Jahre.
China hat jedoch einige bemerkenswerte Ausnahmen gemacht. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums werden 34 Spirituosenhersteller aus der EU von den Zöllen befreit, sofern sie die zuvor vereinbarten Preisverpflichtungen vollständig einhalten. Zu den befreiten Unternehmen gehören bekannte Marken wie Martell (im Besitz von Pernod Ricard) und Rémy Martin (im Besitz von Rémy Cointreau).
Insbesondere werden Antidumpingzölle nicht rückwirkend auf Spirituosenlieferungen aus der EU erhoben, die zwischen dem 11. Oktober 2024 – dem Tag der Einführung der volläufigen Zölle – und dem 4. Juli 2025 importiert werden.
Der Sprecher der Europäischen Kommission, Olof Gill, kritisierte die Entscheidung scharf und bezeichnete die Maßnahmen Pekings als „unfair und unbegründet“.
Der bisherige freiwillige Zoll von 39 Prozent wurde von China ab Oktober 2024 im Rahmen einer Antidumpinguntersuchung eingeführt. Formal wurde die Untersuchung aufgrund einer Petition der China Wine Association vor einem Jahr eingeleitet. Analysten sehen den Schritt jedoch als Teil einer Reihe von Handelsvergeltungsmaßnahmen Chinas auch Reaktion auf die Entscheidung der EU, Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben. Neben der Spirituosensteuer hat Peking auch Zölle auf Fleisch- und Milchprodukte aus der EU vorgeschlagen und Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht.
Pekings Schritt erfolgt, nachdem die EU Ende Oktober 2024 offiziell dauerhafte Zölle von bis zu 35,3 Prozent auf chinesische Elektroautos genehmigt hatte – ein Musterbeispiel für gegenseitige Vergeltung. Frankreich hatte sich zuvor dafür eingesetzt, Zölle auf Spirituosenexport nach China zu verhindern. Dieses Thema wurde in hochrangigen Gesprächen angesprochen, vom Besuch von Präsident Emmanuel Macron in Peking im Jahr 2023 bis zum Besuch des französischen Premierministers François Bayrou im Januar 2025.
Trotz Dialogbemühungen sorgt das Handelsdefizit zwischen der EU und China weiterhin für Spannungen. Laut Eurostat verzeichnete die EU im Jahr 2024 ein Handelsdefizit mit China in Höhe von 304,5 Milliarden Euro. Die Exporte glauben auf 213,3 Milliarden Euro, die Importe aus China auf 517,8 Milliarden Euro. Obwohl der Anteil der Importe aus China leicht um 0,5 % und die Exporte nach China um 4,5 % zurückgingen, blieb China der größte Handelspartner der EU bei den Importen und der drittgrößte bei den Exporten.
Zahlen der Generalverwaltung des Zolls der Volksrepublik China bestätigen diesen Trend: Der gesamte bilaterale Handel erreichte im Jahr 2024 785 Milliarden USD (+0,4 %), wovon China 516,46 Milliarden USD (+3 %) in die EU exportierte und 269,36 Milliarden USD (-4,4 %) importierte.
Das Treffen zwischen Außenminister Wang Yi und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas am 3. Juli in Brüssel im Rahmen des 13. EU-China-Dialogs spiegelte die Bemühungen um eine Wiederbelebung der Zusammenarbeit wider, offenbarte aber auch erhebliche Unterschiede. Frau Kallas betonte die Notwendigkeit, das Handelsungleichgewicht zu verringern, unbedingt für den Export seltener Erden aufzuheben, die Unterstützung Russlands zu beenden und einen bedingungslosen Waffenstillstand in der Ukraine zu unterstützen. Die chinesischen Diplomatin wies die Seltenen Erden-Frage zurück und betonte, China unterstütze Moskau weder finanziell noch militärisch.
Bemerkenswert ist laut Bloomberg, dass Peking den Gipfel zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Beziehungen zwischen der EU und China, der ursprünglich auf zwei Tage (July 24-25) angelegt war, auf nur einen Tag verkürzt hat – ein Schritt, der vermutlich das Ausmaß der Spannungen und den Mangel an Konsens zwischen beiden Seiten widerspiegelt.
Harter Deal, großer Unterschied
Die Handelsspannungen zwischen China und der EU entstehen vor dem Hintergrund einer zunehmend fragmentierten globalen geopolitischen Landschaft, insbesondere unter der Politik der „bilateralen Präferenz“ der Trump-Regierung. Seit April erhebt Washington 20-prozentige Zölle auf Importe wichtiger Partner, darunter der EU und China. Der EU wurde eine vorübergehende Ausnahme von 90 Tagen gewährt – die Frist endete am 9. Juli.
Laut dem Wall Street Journal schlugen die USA der EU vor, einen gemeinsamen Zoll von 10 Prozent einzuführen, um die Handelsfront zu vereinheitlichen. Europa äußerte sich jedoch skeptisch, ob eine Einigung möglich sei. Unterdessen sanken die USA im Mai ihre Zölle auf China von 120 Prozent auf 54 Prozent und erhöhten den Druck durch Drittländer.
Beobachter meinen, die eskalierenden Handelsspannungen zwischen der EU und China seien nicht nur das Ergebnis einzelner Zollmaßnahmen, sondern spiegelten auch strukturelle Unterschiede im strategischen Denken und in der Interessenwahrnehmung beider Seiten wider.
Sergei Lukonin, Leiter der Abteilung für chinesische Wirtschaft und Politik am Zentrum für Asien-Pazifik-Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften, hält eine Handelskonfrontation für unvermeidlich. Er erklärt, dass Europa sich zunehmend auf den Schutz seiner Industrien konzentriert, während China angesichts eines zunehmend abgeschotteten US-Marktes gezwungen ist, nach alternativen Absatzmärkten zu suchen – wobei Europa Priorität habe. Hohe US-Zölle auf chinesische Waren machen die EU für Peking zu einem wichtigen „Ausgleichskanal“, um das Exportwachstum aufrechtzuerhalten.
Laut Sergej Lukonin vertritt Europa jedoch neben rein wirtschaftlichen Interessen auch politische und wertorientierte Forderungen, die Peking nicht akzeptieren kann. Die Integration von Forderungen wie der Beendigung der Unterstützung Russlands im Ukraine-Konflikt oder der Aufhebung von Bedingungen für seltene Erden in Handelsabkommen durch die EU hat zu einem erheblichen Engpass geführt. Wedomosti zitierte Sergej Lukonin mit den Worten: „Peking kommt mit der Botschaft der gegenseitigen Bereicherung und Entwicklung an die EU, während Europa nach einer Gewinn-Verlust-Logik agiert.“
Artem Sokolov, wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGIMO-Institut für Internationale Beziehungen, ist der Ansicht, dass die EU in ihrer Kommunikationsstrategie und Agendasetzung gegenüber China denselben Fehler wiederholt. Ihm zufolge überschätzen europäische Verhandlungsführer oft die Überzeugungskraft ihrer Argumente und seien nicht vernünftig genug, um die geopolitischen Realitäten und die Psychologie ihrer Partner zu berücksichtigen.
Obwohl es einen „gemeinsamen Feind“ gibt – die Hochzollpolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump –, ist es der EU und China bislang offensichtlich nicht gelungen, die Gelegenheit zu nutzen, eine gemeinsame Handelsfront zu etablieren oder einen Rahmen für einen nachhaltigen Dialog zu schaffen.
Hung Anh (Mitwirkender)
Quelle: https://baothanhhoa.vn/trung-quoc-va-lien-minh-chau-au-cung-co-loi-hay-duoc-mat-254056.htm



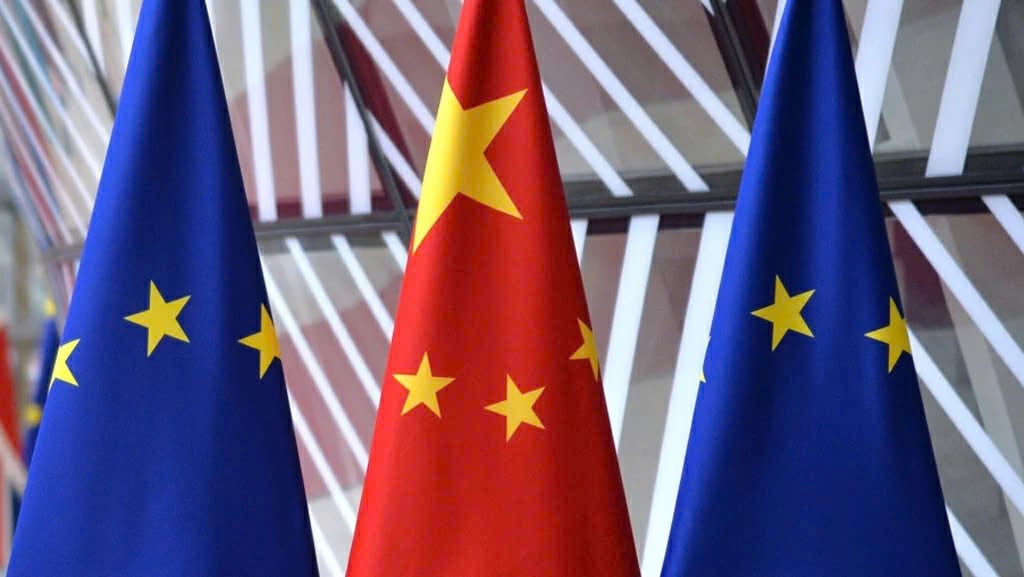












































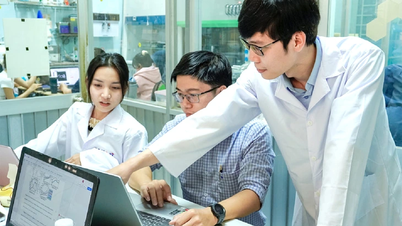































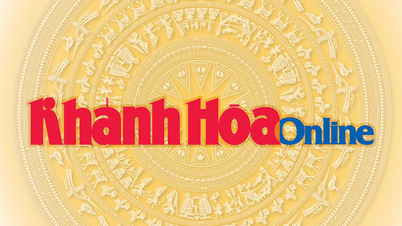




















Kommentar (0)